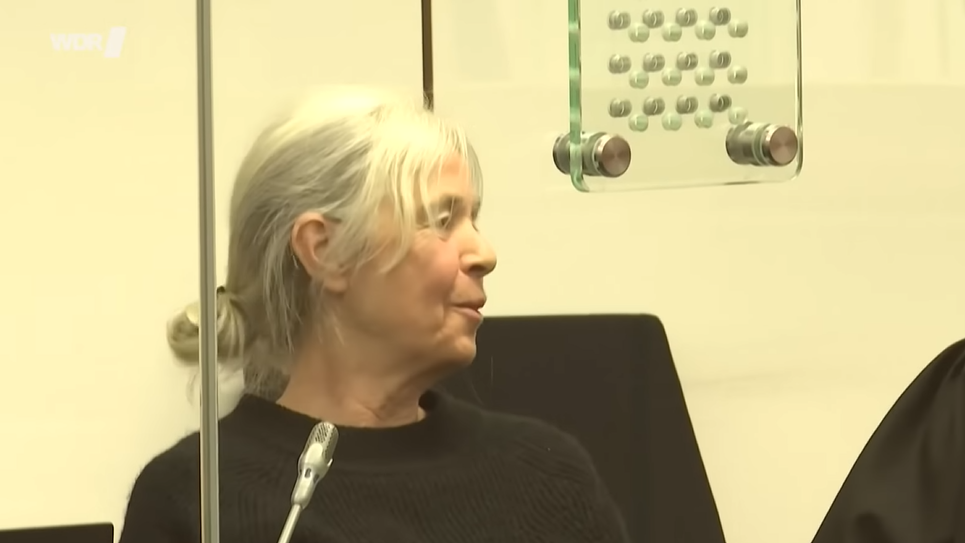Das Verhandlungspapier der „AG 1 – Innen, Recht, Migration und Integration“ mit Stand vom 24. März fordert massive Verschärfungen in der Innen-, Sicherheits- und Migrationspolitik. So wollen Union und SPD eine „Sicherheitsoffensive“ starten, bei der sie „europa- und verfassungsrechtliche Spielräume ausschöpfen“. Das Verhältnis zwischen Sicherheit und Datenschutz wollen sie dabei „neu austarieren“. Damit ist der Tenor gesetzt – Lichtblicke wie etwa beim digitalen Verbraucherschutz oder bei geplanten Maßnahmen gegen digitale Gewalt verblassen vor diesem Hintergrund.
Mehr Überwachung aller Art
Einig sind sich die Koalitionäre beispielsweise, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung für IP-Adressen und Portnummern wieder eingeführt werden soll. Offen ist nur noch, wie lange die Metadaten gespeichert werden sollen. Die allgemeine und wahllose Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten ist juristisch hoch umstritten: Das Bundesverfassungsgericht erklärte sie erstmals im Jahr 2010 für verfassungswidrig, hohe europäische Gerichte haben ihr enge Grenzen gesetzt.
Sicherheitsbehörden sollen zudem in Zukunft eine „automatisierte Datenrecherche und -analyse sowie den nachträglichen biometrischen Abgleich mit öffentlich zugänglichen Internetdaten, auch mittels künstlicher Intelligenz, vornehmen können.“ Konkret bedeutet dies die Einführung einer Big-Data-Software sowie eine biometrische Internetrasterfahndung. Dafür benötigen die Behörden eine riesige biometrische Datenbank möglichst aller Bilder, die im Internet aufzufinden sind. Laut der KI-Verordnung ist das Erstellen einer solchen Datenbank in der EU verboten. Es ist also unklar, wie das rechtssicher geschehen soll.
Beide Parteien wollen zudem die Videoüberwachung an sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten ausbauen und Auto-Kennzeichenscanner im Aufnahmemodus legalisieren. Außerdem sollen Polizeien künftig einfacher untereinander Daten austauschen können. Auch KI-gestützte Auswertungen großer Datenmengen à la Palantir sollen den Behörden „für bestimmte Zwecke“ erlaubt werden.
Drastische Verschärfungen bei Migration
Wenig überraschend enthält das Papier auch massive Verschärfungen der Migrationspolitik. Darauf hatten sich die Unionsparteien und die SPD bereits in ihren Sondierungen geeinigt. Der vergleichsweise lange Abschnitt zum Thema beginnt mit der Ankündigung, das Grundrecht auf Asyl bleibe „unangetastet“. Angesichts der vorgeschlagenen Einschränkungen erscheint diese Behauptung geradezu zynisch.
Zu den angestrebten Maßnahmen zählen etwa eine Einschränkung des Familiennachzugs, die Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten, ein „dauerhafter Ausreisearrest für ausreisepflichtige Gefährder“ und die Abschaffung eines Pflichtverteidigers bei der Durchsetzung von Abschiebungen. Auch Aufnahmeprogramme wie das für zurückgelassene Ortskräfte aus Afghanistan sollen abgeschafft werden.
Union und SPD wollen zudem mehr Rückführungsabkommen mit Drittstaaten schließen und in diesem Zusammenhang auch „Visa-Vergabe, Entwicklungszusammenarbeit, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen“ als Druckmittel einsetzen. Darüber hinaus soll es Leistungskürzungen für „Ausreisepflichtige“ geben.
Die Horrorliste der Union
Bei den bisher genannten Punkten sind sich Union und SPD offenbar weitgehend einig. Die Unionsparteien haben in dem Papier aber noch etliche blau markierte Wünsche ergänzt, die zu weiteren erheblichen Verschärfungen der Innen- und Sicherheitsbehörden führen würden.
Demnach sollen künftig alle Sicherheitsbehörden einfacher Staatstrojaner erhalten. Außerdem sollen Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste „im Einzelfall zur Entschlüsselung und Ausleitung von Kommunikationsinhalten an Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrbehörden“ verpflichtet werden. Das würde letztlich auch ein Ja zur EU-Chatkontrolle bedeuten. Im Verhandlungspapier lehnt die SPD diese immerhin explizit ab.
Die CDU fordert zudem, dass an „Bahnhöfen, Flughäfen und anderen Kriminalitäts-Hotspots“ eine „automatisierte Gesichtserkennung zur Identifizierung schwerer Straftäter“ eingeführt wird – was nach Echtzeit-Fahndung klingt und laut der KI-Verordnung jedoch nur für eine Reihe von bestimmten Straftaten wie Mord, Vergewaltigung oder Menschenhandel erlaubt ist.
Geht es nach CDU und CSU, wird auch die Teil-Legalisierung beim Cannabis rückgängig gemacht. Millionen Kiffer:innen könnten damit schon bald wieder von Strafverfolgung bedroht sein.
Auch bei der Migration möchte die Union eine noch härtere Linie fahren als die SPD. Personen sollen schon dann abgeschoben werden können, wenn sie einfache Straftaten begehen oder wenn sie „Konflikte auf deutschem Boden austragen“ – was auch immer das konkret heißt. Auch soll es Abschiebungshafteinrichtungen in der Nähe von Flughäfen geben.
Außerdem sollen die Duldungsgründe für Ausländer zusammengestrichen werden. Die Unionsparteien wollen zudem bestimmte Asylverfahren in Drittstaaten durchführen. Das sogenannte „Ruanda-Modell“ macht derzeit in der EU Schule, die Unionsparteien wollen entsprechende Initiativen anderer EU-Staaten fördern.
Gewaltschutz für Frauen
Während SPD und Union staatliche Überwachungsmaßnahmen an vielen Stellen ausbauen, haben sie zugleich einige Forderungen von Fachleuten zum Schutz vor digitaler Gewalt im Privaten übernommen. So wollen Union und SPD etwa die Strafbarkeitslücken im Fall von bildbasierter sexualisierter Gewalt schließen – gemeint sind etwa sexualisierte Deepfakes oder das Teilen von intimen Bildern ohne Zustimmung.
Auch zu Spionage-Apps, die oft für Partnerschaftsgewalt eingesetzt werden, positionieren sich die Parteien. „Hersteller von Tracking-Apps sollen verpflichtet werden, das Einverständnis der Gerätebesitzerinnen und -besitzer regelmäßig abzufragen“, heißt es dazu im Papier. Heimlich laufende Apps würden damit verboten.
Die künftige Koalition will außerdem den Tatbestand der Nachstellung verschärfen und das Gewaltschutzgesetz so ausbauen, dass es auch eine Rechtsgrundlage für die Anordnung von elektronischen Fußfesseln und verpflichtenden Anti-Gewalt-Trainings „für Täter“ schafft. Die Einführung solcher Fußfesseln gilt als umstritten.
Die genannten Maßnahmen stehen unter der Überschrift „Gewalt gegen Frauen“. Dass auch trans* oder nicht-binäre Personen als besonders verletzliche Gruppen von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, unterschlagen die Verhandelnden.
Weitere Kompromisse, weitere Verschärfungen
Das Verhandlungspapier enthält auffällig viele Verhandlungswünsche der Unionsparteien, die SPD macht deutlich weniger Vorschläge. Für einen Abschluss der Verhandlungen werden also weitere Kompromisse nötig sein. Hier stehen sich dann unterschiedliche Themengebiete gegenüber wie etwa die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs (SPD) und die Einführung von Hintertüren bei der Verschlüsselung (Union). Der Koalitionsvertrag kann somit die Grund- und Freiheitsrechte noch weit stärker einschränken als der aktuelle Verhandlungsstand es vorsieht.
Das Papier ist mutmaßlich der letzte Stand der ersten Phase der Koalitionsverhandlungen. Am gestrigen Montag sollten alle 16 Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorlegen.
Die finalen Vorschläge und Vorhaben aller Arbeitsgruppen werden nun miteinander abgestimmt. Offene Punkte werden dann auf der nächsthöheren Ebene in einer 19-köpfigen Verhandlungsgruppe aus den Spitzen beider Parteien beraten.
Geht es nach den Plänen von Friedrich Merz, soll der Koalitionsvertrag noch vor den Osterfeiertagen fertig werden und die Wahl zum Bundeskanzler am 23. April stattfinden.
Zuerst veröffentlicht auf Netzpolitik.org (CC BY-NC-SA 4.0).