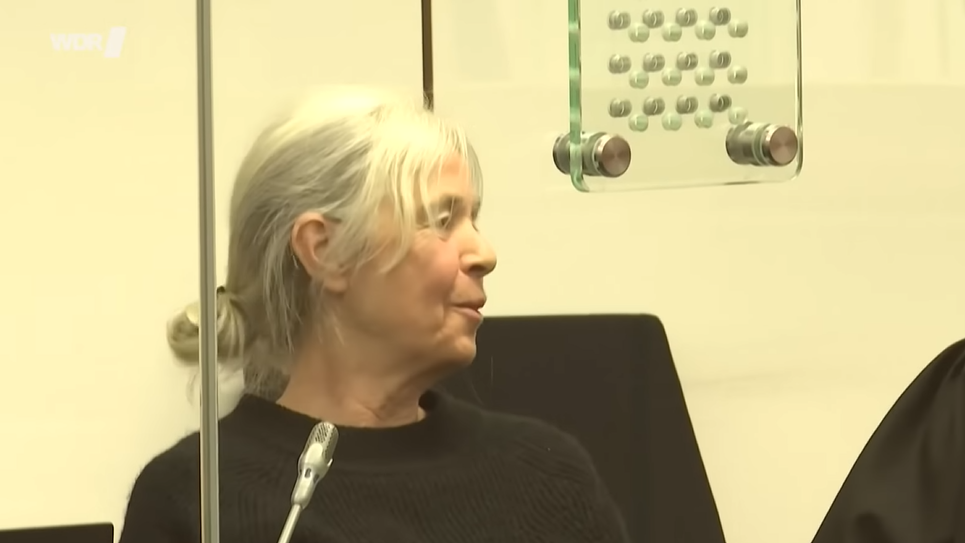Die Razzia bei Fabian Kienert, Redakteur des Freiburger Non-Profit-Senders Radio Dreyeckland (RDL), wegen Verdachts auf Unterstützung einer kriminellen Vereinigung war rechtswidrig, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem erst jetzt öffentlich gewordenen Urteil von Anfang November. Die Polizeiaktion in der Privatwohnung Kienerts im Juli 2022 habe gegen die Pressefreiheit verstoßen, weil Privatwohnungen von Journalisten „ein funktionales Äquivalent zu den Räumen eines Rundfunkunternehmens“ darstellen, so das höchste deutsche Gericht.
Die Polizeiaktion sollte vor allem dazu dienen, die redaktionelle Arbeit zu stören und die Mitglieder des linksalternativen Kollektivs einzuschüchtern. Ein tragfähiger Anfangsverdacht, der die Hausdurchsuchung gerechtfertigt hätte, habe nie existiert, so die Argumentation der Richter.
„Ich hoffe, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu beiträgt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft weniger leichtfertig mit Grundrechten umgehen“, so Kienert nach dem Urteil.
Die zugrunde liegende Verfassungsbeschwerde hatte er gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) eingereicht. Verfahrenskoordinator David Werdermann warnt: „Durchsuchungen in Redaktionsräumen und Wohnräumen von Journalist*innen gefährden das Redaktionsgeheimnis und den Quellenschutz. Ein so schwerer Eingriff in die Pressefreiheit kann nicht auf vage Vermutungen gestützt werden.“ Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fiel am 3. November, die Gesellschaft für Freiheitsrechte machte das Urteil am 19. November bekannt.
Das war der Grund für die Hausdurchsuchung
Kienert hatte im Juli 2022 in einem Beitrag für Radio Dreyeckland einen Link zur Seite linksunten.indymedia.org gesetzt. Im Artikel schrieb er darüber, dass Ermittlungen gegen eine Gruppe wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung im Zusammenhang mit linksunten.indymedia.org eingestellt worden waren. Und dass die linksradikale, offene Posting-Plattform unter ihrer Adresse weiter als Archiv einsehbar sei.
Eine Archivseite konnte Kienert nur noch deshalb verlinken, weil linksunten.indymedia.org 2017 als Reaktion auf die Hamburger G20-Krawalle durch Verfügung des Bundesinnenministerium verboten worden war, mit der Begründung, dass auf der Plattform öffentlich zur Begehung von Gewaltstraftaten gegen Polizeibeamte und politische Gegner sowie zu Sabotageaktionen gegen staatliche und private Infrastruktureinrichtungen aufgerufen werde.
Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe kontruierte daraus den Vorwurf der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Das Karlsruher Amtsgericht erließ einen Durchsuchungsbeschluss, den das Oberlandesgericht Stuttgart später bestätigte.
Im Januar 2023 durchsuchte die Polizei durchsuchte Kienerts Wohnung, die Wohnung des Geschäftsführers von Radio Dreyeckland und schaute auch in den RDL-Redaktionsräumen vorbei. Bei Kienert stellte sie Laptop, Handys und zahlreiche USB-Sticks sicher.
Kienert siegt auf ganzer Linie
Im September 2024 wurde Kienerts Freispruch rechtskräftig. Weil die verbotene Vereinigung linksunten.indymedia.org zum Zeitpunkt der Link-Setzung gar nicht mehr existiert habe, hätte Kienert sie mit dem Link auch nicht unterstützen können, so die damalige Argumentation des Landgerichts Karlsruhe. Zuvor waren bereits die Durchsuchungen der Redaktionsräume und der Wohnung des Geschäftsführers für rechtswidrig erklärt worden.
Nun folgt die nachträgliche Bewertung durch das Bundseverfassungsgericht, dass die Hausdurchsuchung bei Kienert ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Pressefreiheit war. Kienert hat auf ganzer Linie gesiegt. Ob das Setzen eines Links generell eine verbotene Unterstützungshandlung sein könnte, lässt das Urteil offen.
Mit Material von Netzpolitik.org (CC BY-NC-SA 4.0).