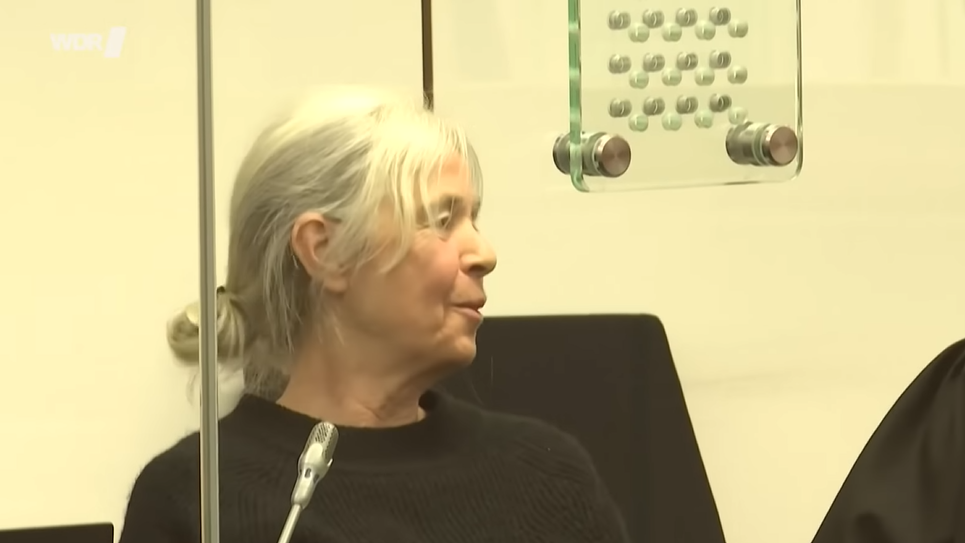Am vergangenen Mittwoch hat ein Mann in Lahr erst seine Ex-Partnerin und anschließend sich selbst getötet. Der 30-jährige Polizist, der zuletzt im Polizeipräsidium Freiburg arbeitete, hat laut Polizei für den Mord seine Dienstwaffe verwendet. Nachbarn hatten zuvor einen Streit des getrennt lebenden Ehepaars in einem Mehrfamilienhaus in der Lahrer Jammstraße mitbekommen und am frühen Abend die Polizei verständigt. Sie berichteten von einer lautstarken Auseinandersetzung, gefolgt von mehreren „Knallgeräuschen“. Als die Beamten kurz darauf am Tatort eintrafen, war in der Wohnung niemand mehr zu erreichen. Beim Betreten der Wohnung trafen sie auf die Leichen der beiden, die Pistole in unmittelbarer Nähe des Mannes. Der genaue Tatablauf ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Andere Personen waren nicht beteiligt.
INFO
In den letzten 20 Jahren gab es in Baden-Württemberg 121 Suizide unter Polizist:innen. In etwa der Hälfte der Fälle verwenden sie ihre eigene Dienstwaffe, berichtet die „Mittelbadische Presse“. Polizist:innen haben im Umgang mit Waffen vergleichsweise große Freiheiten. Auf den Polizeiwachen stehen zwar Schließfächer zur Unterbringungen zur Verfügung, sie dürfen ihre Dienstwaffen aber auch mit nach Hause nehmen, müssen sie dort jedoch in einem Schrank oder Tresor getrennt von der Munition einschließen.
Das mediale Echo des Frauenmordes war immens. Nicht nur Lokalzeitungen berichteten, sondern auch „Bild“ über RTL bis ProSieben brachten die Tat in die nationalen Schlagzeilen. Dabei traten auch Unzulänglichkeiten in der Berichterstattung zu Tage, die eines kritischen Journalismus unwürdig sind: Das Hinterwäldler-Blatt „Schwarzwälder Bote“ betitelte einen Bericht über den Lahrer Mord mit der fahrlässigen und bagatellisierenden Überschrift „Familiendrama“. Ein anschauliches Beispiel dafür, wie wenig sensibilisiert das öffentliche Bewusstsein zum Thema Femizid ist.
Im Jahr 2023 registrierte das Bundeskriminalamt (BKA) 360 Femizide in Deutschland – also Tötungen von Frauen oder Mädchen aufgrund ihres Geschlechts. Das heißt, dass hierzulande fast jeden Tag eine Person aufgrund ihres Geschlechts getötet wird. Die Täter sind in den überwiegenden Fällen Männer, oft Partner oder Ex-Partner der Opfer. Zusätzlich zu den vollendeten Morden gab es im selben Jahr 938 Fälle von versuchten Femiziden. Weltweit wurden im Jahr 2017 mehr als 50.000 Frauen Opfer eines Femizids. Diese Zahlen zeigen, dass Gewalt gegen Frauen ein weit verbreitetes Phänomen von gesellschaftlicher Tragweite ist.
In weiten Teilen der Welt ist die Zahl der Morde an Frauen zwar rückläufig. Dass dieser Rückgang jedoch erheblich langsamer verläuft als die Zahl aller Morde, dass der relative Anteil von Frauenmorden in der Kriminalstatistik also steigt, wirft jedoch Fragen nach der Notwendigkeit politischer Maßnahmen auf.
Keine Einzelfälle
Der Begriff des Femizid ist seit seinem Aufkommen in den 1990er Jahren ein Ausdruck dessen, dass geschlechtsspezifische Gewalttaten gegen Frauen keine isolierten Einzelfälle darstellen, sondern auf bestimmte gesellschaftliche Strukturen zurückgehen, die von patriarchalen, sexistischen oder misogynen Einstellungen geprägt sind. Als Femizide gelten jene Tötungsdelikte, bei denen Frauen aufgrund ihrer Stellung als Frau in der Gesellschaft getötet werden, und nicht etwa aufgrund zufälliger oder individueller Umstände. Während Männer also gewaltsamen Auseinandersetzungen überwiegend mit anderen Männern im öffentlichen Raum zum Opfer fallen, werden Frauen deutlich häufiger als diese von Personen aus dem engsten Umfeld getötet.
„Femizid – die vorsätzliche Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts bzw. aufgrund von ,Verstößen‘ gegen die traditionellen sozialen und patriarchalen Rollenvorstellungen, die Frauen zugeschrieben werden – ist nicht nur die extremste Form geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen, sie ist auch ein extremer Ausdruck ihrer Diskriminierung und der Ungleichheit der Geschlechter.“ – EU-Projekt FEM-United
In Deutschland gibt es bislang keine bundesweit einheitliche bzw. staatliche Definition von Femiziden. Daher lässt sich nur schwer beziffern, wie viele Femizide es tatsächlich gibt. In der polizeilichen Kriminalstatistik werden Femizide nicht gesondert dokumentiert. Einen ersten Versuch, sich einer Erfassungs des Phänomens aus kriminalistischer Perspektive zu nähern, unternahm das BKA im Jahr 2024 mit dem erstmals veröffentlichten Bundeslagebild geschlechtsspezifische Gewalt.
Zu den 360 registrierten Femiziden im Jahr 2023 zählen 155 Tötungen durch Partner oder Ex-Partner sowie 92 Fälle von sonstiger innerfamiliärer Gewalt. Eine besonders hohes Tötungsrisiko besteht für Frauen dann, wenn sie eine Trennung angekündigt oder sich gerade getrennt haben.
Abstruse Gerichtsbeschlüsse
Femizide werden in Deutschland wie andere Tötungsdelikte behandelt, das heißt als Mord (§ 211 StGB) bzw. Totschlag (§§ 212, 213 StGB). Ein gesonderter Straftatbestand „Femizid“, wie es ihn beispielsweise in Mexiko oder Guatemala gibt, existiert im deutschen Strafrecht nicht. Problematisch ist, dass Femizide im Kontext von Partnerschaftsgewalt ‒ insbesondere nach Trennungen ‒ häufig nicht als Mord eingestuft werden. Gerichte berücksichtigen in der Praxis meist nicht, dass Gewaltbeziehungen von Macht und Kontrolle geprägt sind. Stattdessen wirken sich Verlustgefühle und vermeintlich gerechtfertigte Besitzansprüche des Täters regelmäßig strafmildernd aus.
Noch 2004 argumentierte der Bundesgerichtshof in einem Beschluss, eine Bewertung der Beweggründe – ein Merkmal zur Qualifikation als Mord – für einen Femizid als „niedrig” erscheine fraglich, wenn „die Trennung von dem Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt, was er eigentlich nicht verlieren will“. Dies widerspricht den rechtlichen Anforderungen aus internationalen Abkommen zum Schutz von Frauen wie zum Beispiel der Istanbul-Konvention, das auch Deutschland ratifiziert hat.