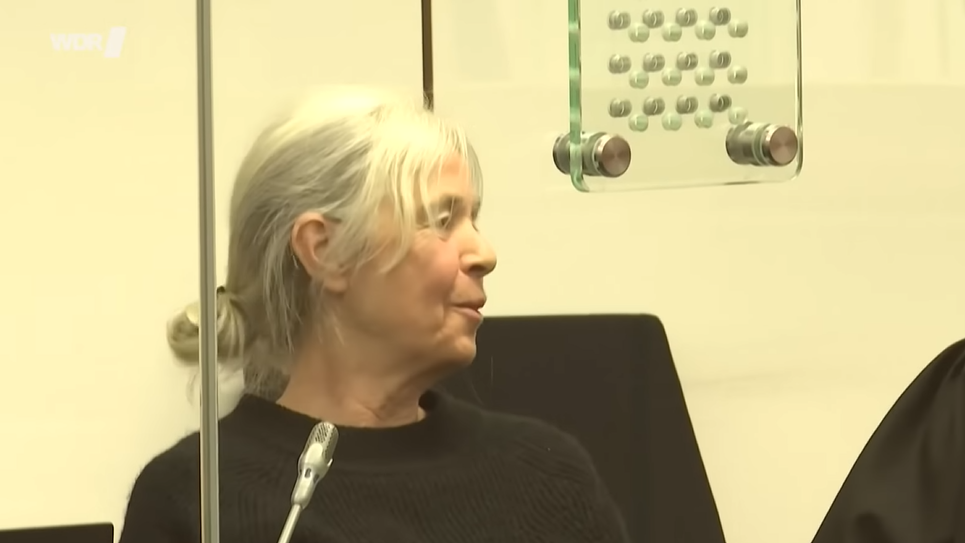„Thiel ist bekannt dafür, dass er die Demokratie ablehnt.” So banal dieser Satz aus dem Archiv des SWR auch klingt, er sagt im Grunde schon alles. Geschäfte machen mit einem Silicon-Valley-Milliardär wie Thiel, der die Demokratie nicht nur offen „ablehnt“, sondern alles daran setzt, sie zu zerstören und durch seine technofeudale Utopie zu ersetzen, könnte sich früher oder später als problematisch erweisen. Mag jedem überzeugten Demokraten soweit einleuchten. Doch die grün-schwarze Landesregierung weiß es offenbar besser und hat am Mittwoch ihre parlamentarische Mehrheit im Landtag eine Änderung des Landespolizeigesetzes beschließen lassen und damit die Rechtsgrundlage für den geplanten Einsatz der Analysesoftware “Gotham” des amerikanischen Tech-Unternehmens Palantir geschaffen. Das System soll in den kommenden Monaten Zugriff auf sämtliche Datenbanken der Polizei bekommen, die Beamte bislang noch aufwendig händisch auswerten müssen – Daten wie Ermittlungsakten, erspähte Anruflisten, ausgelesene Daten aus beschlagnahmten Geräten und so weiter. Eben “neue, zeitgemäße Zugriffe für das digitale Zeitalter”. Und so können doch auch debile Alte einfacher geortet werden, wenn sie wieder mal aus dem Heim ausbrechen. Eine „Experimentierklausel“ im Gesetz gibt darüber hinaus polizeiliche Datenschätze für kommerzielle Unternehmen frei. KritikerInnen warnen vor einer „Rasterfahndung per Knopfdruck“ und sehen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt.
Das Ergebnis der Abstimmung im Landtag war wenig überraschend. Vorausgegangen war ein zierlicher Streit, nachdem Innenminister Thomas Strobl (CDU) Fakten geschaffen hatte: Beamte seines Ministerium haben Anfang März – ohne Rechtsgrundlage – den Rahmenvertrag mit Palantir abgeschlossen. Das Innenministerium beteuert, man habe sich bereits im März gemeinsam auf Palantir als Dienstleister verständigt, die Grünen bestreiten das. Schlussendlich lohnt sich der Deal aber auch für sie. Denn für die Zustimmung zum Überwachungsgesetz gibt die CDU im Gegenzug ihr Veto bei der Vergrößerung des Nationalparks Schwarzwald auf, was noch vor der Sommerpause so vereinbart wurde. Ein politischer Kuhhandel baden-württembergischer Art.
Mehr oder weniger beschlossene Sache
Schon im Koalitionsvertrag vom September 2024 hatten sich Grüne und CDU auf eine Reform des Polizeigesetzes verständigt. Die Schaffung einer rechtlichen Grundlage für den Einsatz von automatisierter Datenanalyse war zum Zeitpunkt von Strobls Vorstoß somit mehr oder weniger beschlossene Sache. Die entscheidente Frage war nicht mehr ob, sondern nur noch welche Software in der baden-württembergische Polizei zum Einsatz kommen soll. Und auch diese Frage war rasch beantwortet, dafür hat Strobl gesorgt.
Nachdem dessen Geheim-Deal im März öffentlich wurde, meldeten einzelne Grüne oberflächliche Kritik an. Ihr innenpolitische Sprecher Oliver Hildenbrand warf gar die Frage in den Raum, ob es richtig sei, als Landesregierung mit einer “solch fragwürdigen und auch demokratiegefährdenden Firma” zusammen zu arbeiten. Wer jetzt schon Verträge abschließe, handele “unabgestimmt, voreilig und falsch.“ Er habe vor Empörung sogar einen Fragenkatalog ins Innenministerium geschickt! Dabei mögen die mahnenden Worte in Richtung CDU für manche Teile der grünen Parteibasis authentisch gewirkt haben, immerhin waren Kreisverbände wie Ulm, Tübingen, Mannheim oder Karlsruhe von Anfang an mehrheitlich gegen den Einsatz von Palantir. Ein Parteimitglied aus Freiburg startete sogar eine Petition an den Landtag, die bis Mittwoch mehr als 13.000 Unterstützer unterzeichneten und noch kurz vor dem gestrigen Beschluss im Petitionsausschuss zu einigen Kontroversen führte. Mit öffentlichen Bekundungen und hilflosen Appellen erschöpfte sich das Arsenal an Methoden der politischen Intervention dann aber auch schon.
Demokratie kennt Grenzen
Der Grünen-Abgeordnete Hildenbrand betont, seine Fraktion habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: „Ich will es ganz offen sagen, wir hätten lieber keinen Vertrag mit Palantir. Aber das Innenministerium hat einen solchen Vertrag bereits vor Monaten abgeschlossen, ohne unser Wissen, ohne unsere Zustimmung.“ Ein Vertrag im Umfang von 25 Millionen Euro, angelegt auf fünf Jahre, ohne Kündigungsrecht. Heißt: Das Land muss die volle Summe an das Unternehmen zahlen, auch wenn es den Einsatz der Software stoppen (z.B. nach einem Gerichtsurteil) oder auf eine Alternative umschwenken sollte. Auf die Frage, warum der Minister ohne erkennbaren Grund, ohne Auftrag des Parlaments, ohne demokratisch legitimiertes Mandat vorzeitig einen Vertrag mit einem der umstrittensten amerikanischen Tech-Unternehmen abgeschlossen hat, antwortete ein Sprecher des Innenministeriums dem SWR, “dass bei Rahmenverträgen üblicherweise günstige Konditionen nur für einen bestimmten Zeitraum gültig seien.” Der Kauf sei bei späterem Vertragsabschluss doppelt so teuer gewesen, heißt es, man hatte augenscheinlich ein unschlagbares Angebot vorliegen, und musste nur noch zugreifen. Alles andere wäre unverantwortlich dem Steuerzahler gegenüber gewesen, so der Unterton.
Datenschutz ist höchstens Ausschussarbeit
Beim Streit um die Software des US-Konzerns geriet die Frage, ob die gesetzliche Regelung zur Erlaubnis der automatisierten polizeilichen Datenanalyse den verfassungsrechtlichen Vorgaben entspricht, irgendwann in den Hintergrund, auch wenn der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte Tobias Keber in einer Stellungnahme eine ganze Reihe von Kritikpunkten aufgeworfen und im Petitionsausschuss dargelegt hatte. Die Verabschiedung des Gesetzes vermochte aber auch er nicht aufzuhalten.
Seine Fraktion, so Hildenbrand im Zuge der Abstimmung im Landtag, habe der Polizei das Instrument eh nicht über Jahre vorenthalten wollen. Damit gibt er sich endgültig geschlagen, von der anfänglichen Kritik ist nichts mehr übrig. Er stützt nun sogar die öffentliche Argumentation von Minister Strobl, der Palantir als „technologischen Marktführer auf dem Gebiet“ und damit als praktisch alternativlos bezeichnet hatte. Das jedoch ist alles andere als unumstritten, wie die Konkurrenten des Konzerns nicht müde werden zu betonen.
Der Vertragspartner Palantir war stets alternativlos
Der öffentlichen Diskurs drehte sich seit Beginn der Debatte zu keinem Zeitpunkt um die Frage, ob überhaupt Formen von polizeilicher Massendatenauswertung eingeführt werden sollen. Zu keinem Zeitpunkt war die Diskussion um Art, Ausmaß und vermeintliche Legitimation eines solchen Eingriffes in die Privatsphäre von Millionen von Menschen bestimmend. Mittlerweile ging es auch nicht mehr darum, Aufträge öffentlich auszuschreiben oder ein auf die Polizeiarbeit in Deutschland zugeschnittene Überwachungsprogramm zu finden. Ungeachtet aller datenschutzrechtlichen Bedenken ist das neue Polizeigesetz auf eine Art und Weise zustande gekommen, die allen demokratische Idealen widerspricht. Was hätte eine kritische mediale Auseinandersetzung, die die offensichtlichen Widersprüche im Handeln der Exektivmacht zum Thema hätte und an den Interessen der Öffentlichkeit orientiert wäre, bewirken können?
Die SPD spottet
Ein SPD-Abgeordneter kommentierte süffisant: „Die Grünen haben am Anfang die Klappe groß aufgerissen und am Ende sind sie wie ein Bettvorleger gelandet. Sie haben eben nicht Palantir gestoppt, obwohl sie in der Lage wären es zu stoppen.“ In der Rolle der Opposition forderten er und seine KollegInnen die Regierung obligatorisch auf, den Deal mit einem Unternehmen aus dem engsten Unterstützerkreis von Donald Trump nochmals zu überdenken. Die FPD hingegen unterstützte als Partei der Freiheit die geplanten massiven Einschnitte in die Privatsphäre von Millionen von Menschen von Anfang an bedingungslos.
Die Grünen im Ländle betonen, dass Palantir nur für fünf Jahre im Einsatz sein soll. Die Landtagsfraktion verspricht: „Wir wollen auf eine einsatzbereite Alternative umsteigen – so schnell wie möglich und spätestens bis 2030.“ Ein eigens eingebrachter Entschließungsantrag soll den Ausstiegswillen unterstreichen. Ob die polizeilichen Nutzer aber tatsächlich schon nach kurzer Zeit wieder aussteigen werden, ist fraglich. Denn Palantir-Systeme sind nicht kompatibel mit anderen digitalen Anwendungen. In ein anderes System umzusteigen ist entsprechend aufwendig. Ein Blick nach Hessen und Nordrhein-Westfalen, wo Palantir-Software bereits im Einsatz ist, offenbart die selbstverschuldete Abhängigkeit der Politik von Palantir. In Bayern unterhält etwa ein halbes Dutzend Palantir-Analysten jeweils einen Arbeitsplatz in den Büros des LKA und stellt den laufenden Betrieb der Software sicher.
„Experimentierklausel“ gibt Polizeidaten frei
Mit der Änderung des Polizeigesetzes hat die Mehrheit im Landtag die Polizeidaten für Palantir freigegeben, aber zugleich die Datentore noch viel weiter geöffnet. Denn auch die Verarbeitung von Daten „bei der Entwicklung, dem Training, dem Testen, der Validierung und der Beobachtung von IT-Produkten einschließlich KI-Systemen und KI-Modellen außerhalb von rein wissenschaftlichen Forschungsarbeiten“ ist nun erlaubt. Diese von Strobls Innenministerium „Experimentierklausel“ genannte Regelung allein ist ein Dammbruch, der kommerziellen Unternehmen Zugriffe auf hoheitliche Datenschätze erlaubt, die niemals für solche Zwecke erhoben wurden. Schwiegervater Wolfgang Schäuble, Gott hab‘ ihn selig, hätte es in seinen Amtszeiten als Bundesinnenminister nicht anders gemacht.
Dass selbst „KI-Systeme und KI-Modelle“ dabei explizit enthalten sind, versieht diese Datenfreigabe für Entwicklung und Tests mit einem unkontrollierbaren Element. Denn einmal als Trainingsdaten beispielsweise in KI-Sprachmodelle eingegangen, sind die Daten kaum rückholbar. Als Begründung dient blanker Pragmatismus: „KI-Anwendungen benötigen […] zur Entwicklung und zum Testen realitätsnahe Trainingsdaten.“ Dazu brauche man „die Nutzung polizeispezifischer – in aller Regel auch personenbezogener – Daten“ eben.
Ignoranter gegenüber dem Grundsatz der Zweckbindung, der zum Kern des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung gehört, könnte sich die Landesregierung, vor allem aber die CDU, wohl kaum geben. Es bleibt zu hoffen, dass sich Widerstand dagegen erhebt – sei es auf juristischem, zivilgesellschaftlichem oder autonomem Weg. Noch mehr bleibt aber zu befürchten, dass das zu spät kommt. Bis dahin könnten kommerzielle Unternehmen über diese „Experimentierklausel“ den polizeilichen Datenschatz längst geplündert haben.
Dobrindt schielt auf Einführung von Palantir auf Bundesebene
Die Zustimmung in Baden-Württemberg könnte ein Vorgeschmack auf die anstehenden Diskussionen für die Pläne auf Bundesebene sein, die seit dem Sommer bekannt sind: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will die Datenbestände der Polizeien des Bundes zusammenführen und analysieren lassen. Das hatten CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Ob Dobrindt dafür auch auf Palantir setzen wird, ist noch nicht bestätigt.
Im Gegensatz zum grünen Spitzenpersonal in Stuttgart werden die oppositionellen Bundes-Grünen in Berlin nicht müde, ihre Ablehnung gegen Palantir zu demonstrieren. Sie setzen sich deutlich von Milliardär und Palantir-Investor Peter Thiel ab, lehnen in einem Sechs-Punkte-Plan von letzter Woche „jede Form digitaler Massenüberwachung ab, von der Chatkontrolle über die anlasslose Vorratsdatenspeicherung und öffentliche Gesichtserkennung bis hin zum Einsatz von Palantir-Software“. Dass konkret Palantir und generell automatisierte Datenfahndung alternativlos seien, sehen sie offenbar anders als ihre Parteifreunde im Südwesten.
Mit Material von Netzpolitik.org (CC BY-NC-SA 4.0).